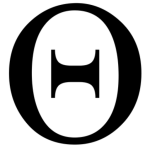Für sechs Wochen bin ich im National Office der UCC, letztes Wochenende besuchte ich die Partner-Konferenz der EKiR, die UCC Penn Central Conference in Harrisburg. Am Samstag war ein Partnerschaftstreffen verabredet. Eine kleine Gruppe von Pfarrerinnen und Pfarrern erwarteten mich am Vormittag, ich hatte eine Präsentation vorbereitet. Am Anfang eine Vorstellungsrunde, jeder erzählt kurz von sich. Ganz informell. Ich dachte, jetzt beginne ich gleich mit meiner Präsentation und will schon mein Notebook hochfahren, doch dann erklärt der Leiter des Partnerschatfskomitees, man beginne diese Treffen mit einer geistlichen Besinnung. Er gibt drei Impulse. Dann erzählen die Kolleginnen und Kollegen, was ihnen geistlich Kraft gibt, berichten von ihren Erfahrungen von „centering prayer“, den Losungen und Meditation – alles unaufgesetzt und doch sehr persönlich. Warum gelingt es uns in Deutschland nicht, auch so unaufgeregt über geistliches Leben zu reden, ohne zu frömmeln?
An den letzten drei Wochenende habe ich ganz verschiedene UCC-Gottesdienste besucht, ein Pfarrer hielt als Predigt eine Powerpoint-Präsentation im Hawaii-Hemd in einer modernen Kirche in einer Suburb, eine Pfarrerin predigte vor einem Altar mit ewigem Licht in einer Gemeinde, die im nächsten Monat ihr 170 jähriges Jubiläum feiert und aus der deutsch-reformierten Tradition stammt. Eine Gemeinde ist „open and affirming“ – d.h. alle sind unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und Identität eingeladen und willkommen, in einer anderen Gemeinde erlebe ich in der Sunday School eine wort-wörtliche Bibelauslegung. Aber in allen Gemeinden wird im „pastoral prayer“ namentlich für Gemeindeglieder und deren Angehörige gebetet.
Es passt nicht in unsere Kultur, namentlich für Menschen in unseren rheinischen Gottesdiensten zu beten. Aber warum eigentlich nicht? Ich erinnere mich an Chatandachten auf evangelisch.de, bei denen nach einiger Zeit auch Teilnehmende persönliche Gebetsanliegen äußerten. Die anonymere Form des Chats mit der Kanalreduktion auf Text machte dies möglich. Das Internet verändert die Kommunikation, macht es persönlicher.
Zurzeit lese ich ein Buch über die „History of the Evangelical and Reformed Church“. Die Grenzerfahrungen im Westen („frontier“) haben die Gemeinden geprägt, zu denen sich die ausgewanderten Deutschen zusammenschlossen. Aber sie mussten sich umgewöhnen. Der amerikanische Westen war anders als die Heimat in Deutschland. Die Pastoren klagen, dass die Gemeindeglieder lernen mussten, dass sie selbst den Pfarrer bezahlen müssen und nicht mehr darauf setzen konnten, dass dies der Staat tut, wie damals im 19. Jahrhundert in Deutschland. Außerdem gab es wechselseitigen Kontakt mit Predigern der amerikanischen Erweckungsbewegung (Great Awakening). Da viele Gemeinden keine Pfarrer hatten und die theologischen Ausbildungsmöglichkeiten im 18. und 19. Jahrhundert in den USA noch rudimentär für deutsche Geistliche waren, schickten die Missionsgesellschaften, allen voran die Baseler Mission, Pfarrer und Kandidaten der Theologie in die USA. Auch wenn die Gemeinden weiterhin Deutsch sprachen, fand eine Auseinandersetzung mit der amerikanischen Frömmigkeitsstruktur statt. Gemeindeglieder mussten mehr Verantwortung für ihre Kirchen übernehmen. Das Gemeindeleben wurde persönlicher. In der Gemeinde, deren Gottesdienst ich am Sonntag besuchte, trugen sich die Kirchgänger in Gottesdienstlisten ein, in anderen Gemeinden gibt es ein „welcome kit“ für neue Gottesdienstbesucherinnen und –besucher. Man weiß mehr voneinander, man merkt, wenn jemand fehlt. Und man tritt mehr füreinander ein – dazu gehört auch ganz amerikanisch – das „pastoral prayer“.
Ob nun bedingt durch die Erfahrungen der „frontier“ oder die Kommunikationsformen im Internet, Gottesdienste können auch sehr persönlich werden. Zumindest in den USA und im Internet.