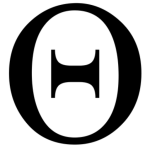Kirchen bestehen aus Stein und nicht aus Bytes, ohne die direkte Begegnung face-to-face geht es nun mal nicht. So wird oft innerhalb der Kirche argumentiert. »Wir brauchen keine Denkmäler«, schreibt dagegen Piotr Czerski in einem Essay. Man darf die Kirchen aus Stein gegen die Bytes sozialer Netzwerke nicht ausspielen, meint Matthias Jung in diesem Gastbeitrag auf Theonet.de.
I Einleitung
Früher war alles besser. Da gab es noch kein Internet und keine Handys und all diesen neumodischen Kram. Telefone hatten Schnüre und von Anrufbeantwortern wussten wir nichts, wenn wir nicht zuhause waren, waren wir eben nicht zuhause. Manchmal war es dann halt schneller einen Brief zu schreiben als über Tage zu hoffen, jemanden endlich ans Telefon zu bekommen. Wenn ich im Fernsehen umschalten wollte, dann musste ich mich vom Sofa erheben. Informationen gab´s im Brockhaus (für die, die das Geld hatten, sich die Prachtausgabe hinzustellen) oder man musste in die Stadtbücherei gehen und in Büchern suchen.
Vor dreißig Jahren gehörte ich zu den »Jungen«, die über die »Alten« grinsten, wenn die von der guten, alten Zeit sprachen, in der alles anders und vor allem besser gewesen war. Heute gehöre ich mit knapp über 50 selbst zu den Alten, zumindest sollte ich mich wohl so fühlen, wenn ich das Essay von Piotr Czerski »Wir, die Netz-Kinder« lese, das vor kurzem in der ZEIT (23.02.2012) erschienen ist. Die Jungen sind heute die, die nicht nur mit dem Internet aufgewachsen, sondern mit ihm verwachsen sind, die von den »Alten« behauptete und beklagte Trennung zwischen realer und virtueller Welt empfindet der junge polnische Autor nicht.
Beim Lesen denke ich allerdings: Eigentlich gehörst du dann doch auch noch zu den Jungen, denn vieles empfinde ich ähnlich. An anderen Stellen regt sich aber auch Widerspruch.
II Wirklichkeit
»Wir sind mit dem Internet und im Internet aufgewachsen. Darum sind wir anders; das ist der entscheidende, aus unserer Sicht allerdings überraschende Unterschied: Wir ›surfen‹ nicht im Internet und das Internet ist für uns kein ›Ort‹ und kein ›virtueller Raum‹. Für uns ist das Internet keine externe Erweiterung unserer Wirklichkeit, sondern ein Teil von ihr: eine unsichtbare, aber jederzeit präsente Schicht, die mit der körperlichen Umgebung verflochten ist.Wir benutzen das Internet nicht, wir leben darin und damit.«
Zunächst einmal Zustimmung. Es fällt auch mir schwer, die Trennung zwischen realer und virtueller Welt nachzuvollziehen, die von vielen propagiert wurde und wird. Ich habe mich immer schon gefragt, ob das nicht viel zu einfach gedacht war und vor allem dazu diente, den moralischen Zeigefinger zu erheben, was denn der technische Fortschritt wieder einmal Schlimmes erdacht hat. Ich erinnere mich dann immer daran, dass auch beim Aufkommen des Kinos und des Radios vom Untergang des Abendlands die Rede war. Natürlich birgt das Internet seine Gefahren, man kann sich in ihm verlieren, und das ist auch nicht schwer, wenn man sich zum Beispiel die medialen, grafischen Traumwelten gerade im Spielbereich anschaut. Aber Traumwelt, genau das ist das Stichwort. Haben »wir Alten« uns nicht früher auch in andere Welten geträumt, wenn wir Karl May gelesen haben oder Jules Verne? Manch eine oder einer mag dadurch auch dem tristen grauen Alltag entflohen sein, wenn sie oder er auf Schiffen die Weltmeere durchpflügte oder mit Raumschiffen zu fernen Galaxien aufbrach.
Die Gefahren liegen doch vermutlich ganz woanders, nicht in der Trennung von Welten und der Aufspaltung von Wirklichkeit. Ja, das Internet ist riesig, vielleicht für viele auch unheimlich und mann und frau hört ja so einiges. Da wird auch manches dran sein, aber ich vermute doch eher, dass es wieder einmal so ist, klare Grenzen markieren zu wollen in einer unübersichtlichen Welt, klar zu trennen zwischen gut und böse. Ja, Grenzen sind auch zu ziehen, aber nicht durch eine Aufteilung der Wirklichkeit. Ich frage eher: wem nützt die Aufspaltung der Welt? Wer versucht da seinen Vorteil draus zu ziehen? Kann es nicht sein, dass das Netz von denen verteufelt wird, die um ihre Pfründe und Gewohnheiten bangen? Ich frage eher: Nach welchen Kriterien bewege ich mich in der einen Wirklichkeit? Wie entscheide ich, wem ich vertraue und wem nicht?
III Identität
»Die Teilnahme am kulturellen Leben ist für uns keine Beschäftigung für den Feiertag: die globale Kultur ist der Sockel unserer Identität, wichtiger für unser Selbstverständnis als Traditionen, die Geschichten unserer Ahnen, sozialer Status, die Herkunft oder sogar unsere Sprache. Aus dem Ozean der kulturellen Ereignisse fischen wir jene, die am besten zu uns passen, wir treten mit ihnen in Kontakt, wir bewerten sie und wir speichern unsere Bewertungen auf Websites, die genau zu diesem Zweck eingerichtet wurden und die uns außerdem andere Musikalben, Filme oder Spiele vorschlagen, die uns gefallen könnten.«
Ich würde fast vermuten, hier sitzt Czerski einem Irrtum auf, wenn er die globale Kultur von den Traditionen der Ahnen trennt. Und auch im Blick auf sozialen Status, Herkunft und Sprache bleiben sicher noch Fragen zu stellen und etwas empirische Forschung wäre auch nicht verkehrt. Die »feinen Unterschiede«, die nach Bourdieu die Menschengruppen voneinander trennen, haben sich vielleicht verschoben. Ja, Grenzen zwischen Menschen und Kulturen scheinen offener zu sein als früher. Aber dennoch bin ich vorsichtiger: Zugang zum Netz haben keineswegs alle, und Sprache ist im globalen Kontext auch nicht ganz unwichtig, ohne Englisch zu können, komme ich auch nicht so wahnsinnig weit. Und ob die Sprachkenntnisse in n so flächendeckend vorhanden sind, ich bin da skeptisch.
Aber die Teilnahme am kulturellen Leben hat sich verändert, ganz sicher. Und das ist gut so, weil der Wunsch, mich auszudrücken und Anerkennung und Wertschätzung dafür zu erhalten, ein menschliches Grundbedürfnis darstellt, das mit den neuen technischen Errungenschaften neue Möglichkeiten eröffnet. Grund zur Euphorie gibt es allerdings nicht, weil die Gefahr der Ausbeutung, das Risiko, benutzt zu werden, sich gleichzeitig auch neu erfindet.
Damit stellt sich mir die Frage: Wie finde ich eigentlich heraus, was zu mir passt? Darauf gibt Czerski keine Antwort, er postuliert einfach, das dies funktioniert. Das finde ich schwierig. Wer leitet die Identitätsfindung, die Auseinandersetzung mit mir selbst an? Unreflektiert besteht aber die Gefahr, auf Bauernfänger, Ideologen und Abzocker herein zu fallen. Und es kommt noch schlimmer.
IV Vertrauen
»Wir müssen auch keine Experten in allem sein, denn wir wissen, wie wir Menschen finden, die sich auf das spezialisiert haben, was wir nicht wissen, und denen wir vertrauen können. Menschen, die ihre Expertise nicht für Geld mit uns teilen, sondern wegen unserer gemeinsamen Überzeugung, dass Informationen ständig in Bewegung sind und frei sein wollen, dass wir alle vom Informationsaustausch profitieren.«
Hier habe ich ganz tief durchgeatmet. Wem kann ich vertrauen? Das ist die Rückseite des Identitätsproblems. Czerski verfällt hier seinerseits in eine fragwürdige Aufteilung der Welt: Vertrauenswürdig sind diejenigen, die sich für die Freiheit des Informationsaustausches einsetzen. Heißt das dann im Umkehrschluss: Wer Geld im Netz für Informationen will, ist nicht vertrauenswürdig?! Und wenn ich ihn hier falsch verstanden haben sollte, bleibt immer noch die Frage, welchen Informationen und Informanten ich vertrauen kann und will.
Ich würde Czerski zustimmen, dass ich im Netz Menschen finden kann, denen ich Vertrauen entgegen bringen kann. Aber er gibt keine Kriterien an. Das gleiche Empfinden, das Teilen der gleichen Herangehensweise, das ist mir zu wenig. Es klingt für mich ein wenig wie der alte Gegensatz von Gesinnungs- vs. Verantwortungsethik. Ich vertraue dem, der die gleiche Gesinnung hat wie ich. Das ist vermutlich ein sehr normal menschliches Verhalten – aber nur bedingt hilfreich bei der Frage nach Gut und Böse…
Vielleicht ist diese Problematik daher viel grundlegender. Berührt sie nicht eine uralte Frage, die sich seit Beginn der Menschheit und durch alle Entwicklungsphasen der Kommunikation hindurch stellt: Wem kann ich eigentlich vertrauen und warum? Und die Kehrseite, das gebrochene, enttäuschte, zerstörte Vertrauen ist genauso ein Menschheitsproblem. Czerski klingt mir hier in seiner Leidenschaft für die neue Kultur zu naiv.
V Kirche
»Wenn wir euch, den Analogen, unseren ›Bildungsroman‹ erzählen müssten, dann würden wir sagen, dass an allen wesentlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben, das Internet als organisches Element beteiligt war.
Die Gesellschaft ist ein Netzwerk, keine Hierarchie. Wir sind es gewohnt, das Gespräch mit fast jedem suchen zu dürfen, sei er Journalist, Bürgermeister, Universitätsprofessor oder Popstar, und wir brauchen keine besonderen Qualifikationen, die mit unserem sozialen Status zusammenhängen. Der Erfolg der Interaktion hängt einzig davon ab, ob der Inhalt unserer Botschaft als wichtig und einer Antwort würdig angesehen wird.«
Hier bin ich dann wieder (fast) ganz bei Czerski. Ich glaube auch, das die Angst vor großen Namen und Institutionen geschwunden ist, vielleicht sogar an manchen Stellen in ein ungesundes grundlegendes Mißtrauen umgeschlagen ist, das genauso fatal ist wie eine kritiklose Zustimmung zu Honoratioren und Einrichtungen.
Ich glaube auch, dass die Gesellschaft ein Netzwerk und keine Hierarchie ist und das an sehr vielen – vielleicht nicht an allen, wie Czerski im Überschwang formuliert, – wesentlichen Erfahrungen das Internet heute beteiligt ist. Oder zumindest beteiligt sein kann.
Das Internet als genuinen Teil der menschlichen Gesellschaft zu verstehen und zu nutzen für die Verbreitung der eigenen Botschaft, davon sind wir in der Kirche noch weit entfernt. Kirchliche Websites sprechen oft eine andere Sprache, veraltete Texte, schlampig programmierte Seiten – es ist nicht so wichtig, wird hier signalisiert. Oder: Suchen Sie mal auf Facebook nach Kirchengemeinden. Sie werden ein paar finden, aber nicht viele. Die kirchlichen Strukturen orientieren sich an der Parochie und Zuständigkeit, nicht an der Frage nach der Überzeugung und am Gleichklang der Gesinnung. Das muss nicht per se schlecht sein, sollte aber in beide Richtungen mit reflektiert werden.
Aufhorchen lässt mich dann aber der Satz:
»Der Erfolg der Interaktion hängt einzig davon ab, ob der Inhalt unserer Botschaft als wichtig und einer Antwort würdig angesehen wird.«
Verkündigung des Evangeliums und Interaktion in den neuen Medien. Eigentlich müsste dies doch ein zentraler Ort kirchlicher Aktivität sein. Es geht uns doch um die Kommunikation. Bei den »Jungen« (wahrscheinlich aber auch – wenn auch anders – bei den »Alten«) hat die Botschaft nur eine Chance, wenn sie als wichtig angesehen wird und entsprechend interaktiv verbreitet wird. Wollen wir so etwas wie eine interaktive Verkündigung? Oder ist uns das Predigen in Leib und Blut übergegangen? Es ist leichter, von der Kanzel herab zu reden. Haben wir uns zu sehr in unseren »alten« Traditionen eingerichtet? Kirchen bestehen aus Stein und nicht aus Bytes, ohne die direkte Begegnung face-to-face geht es nun mal nicht. So wird oft argumentiert. »Wir brauchen keine Denkmäler«, schreibt Czerski. O doch. Auch hier mag ich nicht trennen zwischen Denkmälern aus Stein und anderen aus Bytes.
Es bleibt aber die Frage, wenn ich mich darauf einlasse: Wie bekomme ich die Menschen in die alten Kirchen, wenn die face-to-face Begegnung noch einmal auch ihre unverwechselbaren Stärken besitzt? Wie läuft die Kontaktaufnahme? Die Parochie der Kirchengemeinde hat hier unbestreitbar auch ihre Stärken, weil sie auf langfristige Beziehungen aufbaut und damit auf ein Vertrauen setzt, dass sich über Zeit entwickelt. Das ist richtig – aber gilt für ganz viele Menschen eben nicht mehr, die weder wissen, wohin sie gehören noch wer für sie zuständig ist.
Und hier, so erzählte mir jüngst eine Frau aus meiner Gemeinde, gilt für viele die Kommunikation in Papierform mit Handzetteln und Gemeindebrief als altbacken. Menschen lernen sich heute vermehrt über die Netzwerke im Netz kennen. Sehr oft führt das dann dazu, dass ich die oder den anderen auch real kennen lernen möchte. Das hat dann schon etwas mit »einer Antwort würdig angesehen« zu tun. Als Kirche nutzen wir diese Erfahrung, so mein Eindruck, noch viel zu selten. Um in dieser Form der Interaktion bestehen und d.h. als Gesprächspartner/in akzeptiert zu werden, braucht es Menschen, die sich in diesen Netzwerken authentisch, d.h. selbstverständlich, nicht anbiedernd oder aufgesetzt bewegen. Menschen, die eben Czerski zustimmen und sagen, ja, ich surfe nicht im Internet, sondern das Internet ist selbstverständlicher Teil meiner Identität, meines Lebens, meiner Beziehungen.
Matthias Jung

Matthias Jung ist evangelischer Pfarrer in Götterswickerhamm.
Dieser Blogpost erschien zuerst in Matthias Jungs Blog unter http://matthias-jung.blogspot.de/2012/03/wir-die-netz-kinder-kommentar-aus-der.html, der Essay von Piotr Czerski in der ZEIT unter http://www.zeit.de/digital/internet/2012-02/wir-die-netz-kinder/komplettansicht.