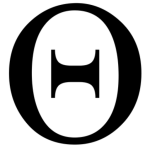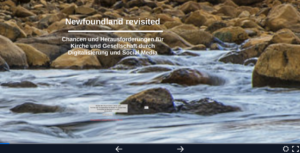
Ziemlich genau ein Jahr ist es her, seit sich die EKD-Synode mit der „Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Gesellschaft“ als Schwerpunktthema beschäftigte.
Innerhalb der Synodentagung wurde ein großer Weg zurückgelegt. Wenn man den vor der Synode veröffentlichten Kundgebungsentwurf und die beschlossene Kundgebung vergleicht, sieht man, wie weit sich die Synode vor einem Jahr bewegt – man kann aber auch sagen, wie weit die Mehrheit im Vorbereitungsauschuss bzw. das was dort konsensfähig war, vom aktuellen Stand der Diskussion entfernt war. Angela Merkel hat für den Satz, dass Internet Neuland sei, viel Häme im Netz abbekommen. Aber das war auch die Ausgangslage der EKD Synode, die Kirche muss sich ein neues Gebiet erschließen. Auch wenn hier das Wort Neuland nicht fällt, formuliert der Kundgebungsentwurf:
„Wir erkennen, wie wenig wir von dem verstehen, was die Entwicklungen bewirken werden. Wir ahnen die Gestaltungsaufgabe, die die umfassende Digitalisierung mit sich bringt.“
So die Ausgangslage. Die EKD-Synode bezog das Thema Digitalisierung auf die Verkündigung des Evangeliums. Wenn man sich einem neuen Land nähert, ist es sinnvoll, sich auf das zu fokussieren, was man am besten kann oder einem am nächsten liegt. Also nicht über Digitalisierung im Allgemeinen debattierte die Synode, sondern wie sich Kirche infolge der Digitalisierung verändern kann und was das für die Verkündigung des Evangeliums bedeutet. Exemplarisch hier die Diskussion aus einer der Arbeitsgruppen.
In der Diskussion zum Kundgebungstext der EKD-Synode wurde in einer Arbeitsgruppe auf den 7. Artikel des Augsburger Bekenntnisses verwiesen, der die Gemeinde definiert als „Versammlung aller Gläubigen […], bei denen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden.” Da online keine Sakramente gefeiert werden könnten (auch wenn es vereinzelt schon Online-Abendmahlsfeiern gegeben hat), so das Argument, besäßen Online-Gemeinden gegenüber Ortsgemeinden ein Defizit und müssten besser als Online-Community beschrieben werden. Andere in der Arbeitsgruppe widersprachen, Predigt und Sakrament seien laut Augsburger Konfession hinreichend Kennzeichen dafür, Kirche in der Welt zu identifizieren, aber keine exklusiven Kriterien. Auch diakonisches Handeln sei Kirche, christliche Unterweisung und katechetischer Unterricht seien Kirche, jede im Namen Jesu versammelte Gemeinschaft sei Kirche – ob diese nun an einem Ort zusammentritt oder sich online zusammenfindet. Dieser Argumentation schloss sich die Mehrheit der Arbeitsgruppe an. Ähnlich argumentierte dann die gesamte Synode, nach einiger Diskussion ersetzte die EKD-Synode das Wort „Community”, das noch im Kundgebungsentwurf stand, durch das Wort „Gemeinde”:
„Die Digitalisierung der Gesellschaft führt dazu, dass durch digitale Räume neue Formen von Gemeinde entstehen. Nicht physische Nähe, sondern Kommunikation ist für sie wesentlich. Die evangelische Kirche respektiert und fördert diese neuen Gestalten von Gemeinde.”
Nun ist es zumindest EKD-amtlich, dass es Online-Gemeinde gibt bzw. in Deutschland geben kann, mehr noch, die EKD sich verpflichtet hat, solche Gemeinden zu fördern. Es war ein längerer Weg zu dieser Erkenntnis, bei der Begründung eines Pilotprojekts hieß es noch 2006 in Bezug auf Online-Gemeinschaften, es sei „ungeklärt”, ob diese „auch Teil des lebendigen Miteinanders der Kirche sind.” Seit letztem Jahr gibt es grünes Licht für Online-Gemeinde.
Doch was hat sich seit der Synode 2014 geändert?
Leider nicht viel. Wie sieht der Besuch im Neuland ein Jahr später aus?
Mein Eindruck ist, nicht viel. Die Synode gibt der Welt etwas kund – Kundgebung ist schon ein antiquiertes Wort –, aber in der Praxis hat sich nicht viel geändert, auch im Sinne einer Selbstverpflichtung hat sich nicht viel getan. Habe ich nach der Synode eine leichte Aufbruchstimmung unter den Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen, so ist dies der Ernüchterung gewichen.
- Die Versionsnummern werden hochgezählt, es gibt nun den Gottesdienst 3.0 – so wie der auf dem Kirchentag gefeierte Twitter-Gottesdienst, aber konzeptionell hat sich nicht viel geändert zu den bisher gefeierten Online-Gottesdiensten.
- Es gab einen Medienkonzil und Johanna Haberer hat ein Buch mit dem Titel Digitale Theologie veröffentlicht.
- Eine Online- Strategie, geschweige denn eine Digitalisierungsstrategie oder eine gar Digitalstrategie gibt es nicht.
Die letzte EKD-Medienstrategie – publizistisches Gesamtkonzept genannt -, stammt aus dem Jahr 1997. Das Internet kommt nur namentlich vor. Versuche, eine Online-Strategie zu entwickeln, gab es, aber das Konzept ist in Gremien versandet.
Nehmen wir wahr, was rechts und links von uns im Neuland geschieht? Thomas Schulz hat in seinem Buch „Was Google wirklich will“ eine gute Übersicht vorgestellt, an welchen Themen Google forscht, experimentiert und Produkte auf den Markt bringt.
Sozialethische und anthropologische Fragen müssten wir neu bedenken, denn die religiöse Dimension des Menschseins kommen in diesem Weltbild von Larry Page nicht vor, technisch scheint alles machbar. Ein naturwissenschaftlicher Optimismus bestimmt das Handeln der Manager im Silicon Valley. Wenn wir in Deutschland darauf reagieren, besonders in kirchlichen Kreisen, greift zuerst ein protestantischer Kulturpessimismus. Bei der anschließenden Diskussion zur Buchvorstellung in einer diakonischen Einrichtung, zielte die erste Frage auf den Datenschutz. Wir definieren „No-Go-Areas“ und sichern durch ein eigenes kirchliches Datenschutzrecht ab, dass wir uns in dieses Terrain nicht begehen müssen bzw. dürfen.
Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft, die Arbeitswelt und auch die Politik. Wer sich bemüht, mit der Digitalisierung verbundene Themen in kirchliche Gremien zu bringen, ist eher Störer denn willkommen.
Von der Leitungsebene wird das Thema aber auch nicht aktiv nach vorne gestellt. Wer auf den neu gewählten Rat der EKD blickt, sieht für das Thema Digitalisierung nur beim aktiven Facebook-Nutzer Bedford-Strohm verortet. Der Ratsvorsitzende bespielt Social Media aktiv, aber deswegen ist Digitalisierung noch kein Chefthema. Für die EKD-Leitungsebene gilt das Gegenteil: Ingo Dachwitz, der seine Kompetenz einbringen wollte und Digitalisierung zu seinem Thema gemacht hatte, wurde nicht in den Rat gewählt.
Niemand will das Thema Digitalisierung haben und das Neuland besiedeln. Fast so war es auch mit Neufundland, im arktischen Norden Kanadas. Die Engländer waren froh, als sie 1949 dieses Gebiet nach Kanada abschieben konnten und es los waren.
Aber wir können die Digitalisierung und den Fortschritt nicht ignorieren oder verdrängen. Unsere Wirklichkeit wird komplexer. Das Internet und die Digitalisierung fordern uns heraus, sie verändern unseren Alltag und wir müssen uns dazu verhalten. Das gilt für die Gesellschaft, aber auch für uns als Kirche. Nicht nur die Gremien müssen sich damit beschäftigen, wir müssen damit auch in die Breite bzw. Tiefe unserer Kirchen kommen.
Neulich war ich auf einem Pfarrkonvent in einem ländlichen Kirchenkreis der EKiR. Nach einer jüngeren Kollegin war ich (zumindest gefühlt) der jüngste Pfarrer in dieser Runde, nur zwei oder drei nutzen selber Social Media und im Vorfeld der Einladung hatte ich zu kämpfen, dass nicht Datenschutz das Hauptvortragsthema wird.
Neben den Bedenkenträgern gibt es aber auch Enthusiasten, wir benötigen jedoch einen realistischen Umgang, der die vielfältigen Herausforderungen und Chancen angeht und in den Alltag unserer Gemeinden bringt. So heißt es beispielsweise in der Social Media-Handreichung der Protestantischen Kirche der Niederlande von 2012:
„Ausgangspunkt ist, dass Social Media einen wertvollen Beitrag zur Arbeit leisten kann, wie EMail und Internet das auch bereits getan haben und noch stets tun. Bei neuen Entwicklungen sieht man oft, dass eine Gruppe vor allem die Gefährdungen sieht und eine andere Gruppe vor allem die Chancen. Der Umgang ist Social Media ist nicht durch Regeln festzulegen. Diese Handreichung wurde entwickelt, damit Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter vor allem die Chancen wahrnehmen und die Gefahren umsegeln.“
Ich möchte also versuchen, differenziert zu argumentieren. Wie positionieren wir uns theologisch? Vielleicht gelingt es uns als Kirche, in dieser Welt auch zu agieren und nicht nur zu reagieren.
Terminologie verrät den Standpunkt
Je nachdem, welche Terminologie ich wähle, beziehe ich schon Position. Liegt nicht Aufgabe der Kirche in der „direkten“ („face-to-face“) Kommunikation des Evangeliums? Eignet sich Social Media überhaupt für Verkündigung und Seelsorge, wenn dort gezwitschert (Twitter) und gequatscht (Chat) wird? Als ob beim Kirchencafé nicht auch einfach nur geredet wird. Die Wahl der eigenen Terminologie zeigt dabei bereits den eigenen Standort. Spricht man von real versus virtuell? Von face-to-face Kommunikation versus computer-vermittelter Kommunikation? Oder von Kohlenstoffwelt versus Netzwelt? Oder von offline und online? Es geht also um die theologische Positionsbestimmung des Internets.
Veränderungen durch Digitalisierung
Ist das Internet ein Instrument, ein Werkzeug oder ein Tool, das sich auch gut für die Kommunikation des Evangeliums nutzen lässt oder geht es um einen fundamentalen Veränderungsprozess in unserer Gesellschaft, um die Entstehung einer neuen digitalen Kultur, in der wir uns als Kirche zurecht finden müssen. Verändert es sogar Grundkonstanten unseres Menschseins?
Internet und Digitalisierung sind natürlich zu differenzieren, aber der Umgang mit dem Internet zeigt sehr deutlich, wie man Digitalisierung versteht.
Ist das Internet nur ein Tool, dann verstehen wir das Internet als ein weiteres Medium, neben Print, Radio oder Fernsehen. Dann tritt die Chatandacht zum Wort zum Sonntag und ergänzt das geistliche Wort im Gemeindebrief. Ein Instrument kann man einsetzen, auf bestimmte Bereiche beschränken oder den Einsatz bleiben lassen, wenn es nicht den angestrebten Erfolg bringt. Digitalisierung so verstanden fügt dem kirchlichen Repertoire einen neuen Kanal hinzu, den es zu bespielen gilt – am besten von Fachleuten, die man sich für diesen Zweig der Medienarbeit am besten holt, um das Feld professionell zu besetzen.
Oder ist Digitalisierung ein grundlegender Veränderungsprozess, in dem sich unsere Gesellschaft befindet, der unseren Alltag und die Struktur unserer Gesellschaft, die Wirtschaft, Unternehmen und Institutionen umfassend verändern wird, neue Wirtschafts- und Erwerbsmodelle hervorbringt und andere obsolet macht? Dann müssen wir uns als Kirche auf diesen gesellschaftlichen oder auch anthropologischen Wandel einstellen, dabei wird sich auch die Kirche verändern.
Oder noch pointierter: Wenn das Handy eine Extension unserer Gliedmaßen wird, ändert sich auch die Anthropologie. Was ist der Menschen, wenn Mikrochips unter der Haut eingepflanzt sind und den Menschen ergänzen?
Jede Veränderung erzeugt Angst
Bei jeder Diskussion des Themas Digitalisierung muss man auch bedenken, dass Veränderungsprozesse Verunsicherung erzeugen, schnell kommt es zu einer Abwehrhaltung, dazu Gunter Dueck, früherer Chefstratege von IBM und IT-Vordenker:
„Wir Deutschen neigen besonders dazu, zu vielen Megatrends zunächst eine Abwehrhaltung aufzubauen: ‘Nein, das wollen wir nicht’ ist die Haltung. Dabei lässt sich Digitalisierung nicht aufhalten. Durch kein Gesetz. Durch keine Blockade.“
Piotr Czerski, geboren 1981, ist ein polnischer Dichter, Autor, Musiker und Ex-Blogger, er schreibt:
“Wir sind mit dem Internet und im Internet aufgewachsen. Darum sind wir anders. Das ist der entscheidende, aus unserer Sicht allerdings überraschende Unterschied: Wir “surfen” nicht im Internet und das Internet ist für uns kein “Ort” und kein “virtueller Raum”. Für uns ist das Internet keine externe Erweiterung unserer Wirklichkeit, sondern ein Teil von ihr: eine unsichtbare, aber jederzeit präsente Schicht, die mit der körperlichen Umgebung verflochten ist.
Wir benutzen das Internet nicht, wir leben darin und damit. Wenn wir euch, den Analogen, unseren “Bildungsroman” erzählen müssten, dann würden wir sagen, dass an allen wesentlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben, das Internet als organisches Element beteiligt war. Wir haben online Freunde und Feinde gefunden, wir haben online unsere Spickzettel für Prüfungen vorbereitet, wir haben Partys und Lerntreffen online geplant, wir haben uns online verliebt und getrennt.
Das Internet ist für uns keine Technologie, deren Beherrschung wir erlernen mussten und die wir irgendwie verinnerlicht haben. Das Netz ist ein fortlaufender Prozess, der sich vor unseren Augen beständig verändert, mit uns und durch uns. Technologien entstehen und verschwinden in unserem Umfeld, Websites werden gebaut, sie erblühen und vergehen, aber das Netz bleibt bestehen, denn wir sind das Netz – wir, die wir darüber in einer Art kommunizieren, die uns ganz natürlich erscheint, intensiver und effizienter als je zuvor in der Geschichte der Menschheit.”
Kulturkampf ums Internet?
Ulrich Schneider-Wedding kritisiert in der März-Ausgabe des Korrespondenzblatts, dem Publikationsorgan des bayerischen Pfarrvereins, in einem Aufsatz mit dem Titel “Digitalisierung als Ersatz-Religion”, dass die evangelische Kirche ihr Wesen zugunsten von Social Media und Digitatliserung aufgibt, die quasi zu einer Ersatz-Religion werden, dem widerspricht der bayerische Social Media Pfarrer Christoph Breit im selben Heft mit einem weiteren Aufsatz “Es gibt kein analoges Leben im Digitalen”.
Es mutet an wie ein Kulturkampf: Bewahrer des echten Lebens und der menschlichen Autonomie gegen die Jünger der Digitalisierung. Unversöhnlich scheinen die Fronten und jeder Versuch, das Thema in Worte zu fassen oder gar in der digitalen Welt zu leben und zu arbeiten wird zum Verrat an Gott, am eigenen Ich, ja am Leben überhaupt.
Breit greift mit seinem Aufsatztitel Michael Seemann auf, der sagt „Es gibt kein analoges Leben im Digitalen. Ist man Teil der Welt, wird man Teil des Internets sein.“
Es geht dabei auch um eine Generationenfrage. Es wächst eine Generation heran, die eine Zeit ohne Internet nicht kennt. Die letzten Jahre weist die ARD/ZDF-Online-Studie für die jüngste Alterskohorte (ab 14) 100% Internetnutzung aus.
Diese Generation hat eine geringere Bindung an die Kirche. Die höheren Alterskohorten weisen zwar höhere Kirchlichkeit aus, aber deutlich geringere Internetaffinität. Nehmen wir dann noch den protestantischen Kulturpessimismus hinzu, sehen wir, welches Problem wir haben.
Nur noch hier der Hinweis auf den EKD-Ratskandidaten Ingo Dachwitz, 28 Jahre, der nach mehreren Umzügen auf der Suche ist, aber zurzeit keine Gemeinde hat. Welche medial vermittelte Partizipation an einem Gemeindeleben bietet ihm seine Kirche? Dass er keine Verbindung zu einer Ortsgemeinde hatte, gereichte ihm bei der Ratswahl zum Nachteil, weil andere Strukturen als die dr Beteiligung vor Ort als defizitär qualifiziert werden.
Das Internet wird die Ortsgemeinden nicht leeren, Online-Partizipation wird nicht die Regel werden, muss aber eine gleichberechtigte Möglichkeit sein.
Wenn wir im Rheinland Grundsatzfragen zu klären haben, zitieren wir im Rheinland gerne die Barmer Theologische Erklärung.
These III der Barmer Theologischen Erklärung verortet die Kirche “mit ihrer Botschaft … mitten in der Welt der Sünde”, These VI bestimmt den Auftrag der Kirche darin, „an Christi Statt und also im Dienst seines eigenen Wortes und Werkes durch Predigt und Sakrament die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk.“ Volkskirche so verstanden koppelt den Auftrag der Glaubenskommunikation daran, an alle Menschen gewiesen zu sein.
Daraus leitet sich der Auftrag kirchlicher Präsenz in Social Media ab. In ihrer Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“ versteht sich beispielsweise die Evangelische Kirche im Rheinland als eine Kirche, „die auf Menschen zugeht (Mt 28,19), um sie mit dem Evangelium in Kontakt zu bringen, sie zum Glauben einzuladen, ihnen zu dienen und sie zur Umkehr zu einem neuen Leben in Gerechtigkeit und Solidarität zu rufen.“ Die rheinische Kirche ist sich bewusst, dass neue Medien wie Internet oder mobile Kommunikation neue Lebenswelten, insbesondere für Jugendliche, entstehen lassen. Daher formuliert sie für sich eine Verpflichtung: ,,[w]ir sind im Dialog sensibel für unterschiedliche Sprachformen und suchen neue Wege der Verkündigung.“ Im Handlungsfeld 2.9 „Öffentlich und persönlich für den Glauben werben“ wird bekräftigt, die Volkskirche biete „eine Fülle von Möglichkeiten, mit dem Evangelium in Kontakt zu treten“. Daher lautet eine der Fragen zur Selbstkontrolle: Welche Einstiegsmöglichkeiten zum Glauben – besonders auch durch neue Medien – werden Suchenden eröffnet? Einen solchen niedrigschwelligen Einstieg bietet Social Media. Eine missionarische Volkskirche muss in sozialen Netzen mit eigenen angemessenen Angeboten präsent sein.
Dabei dürfen und müssen wir uns als Kirche auch in Netzwerke begeben, die uns nicht gefallen, um die Menschen zu erreichen, denen diese Netzwerke gefallen. Das heißt für mich: Auch wenn Facebook in der Welt der Sünde ist, hindert mich nichts, dort das Evangelium zu verkünden, dieses schulden wir nämlich allem Volk. Wenn über 30 Millionen Deutsche auf Facebook kommunizieren, dass richten wir auch dort das Evangelium aus. Täten wir dies nicht, zögen wir uns aus der sündigen Welt zurück und flüchteten uns ins Weltfremde hinter Kirchenmauern. Das aber ist nicht mein Bild von evangelischer Kirche. Bei aller Kritik an Facebook & Co: wir sind – so sehe ich das – von Gott auch in solche Netzwerke gestellt.
Theologisch geht es also um das Wie und nicht um das Ob.
Über zwei Punkte müssen wir jedoch theologisch weiter nachdenken: Die Wahrung einer Privatsphäre und die unserer Leiblichkeit.
Auch im Netz brauchen wir Privatsphäre
Und Gott der HERR machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. (Gen. 3, 21)
Es gibt beim Menschen etwas, was den Blicken anderer entzogen werden soll. Kleidung verdeckt die körperliche Nacktheit, aber wir brauchen auch Schutz gegen die digitale Nacktheit, nicht alle Datenspuren unserer selbst sollen offengelegt werden. Dies müsste theologisch noch weiter begründet werden. Gerade gegenüber Post-Privacy-Vertretern, die zwar totale Informationsfreiheit nicht als Wunschvorstellung propagieren, sondern eher als technisch nicht verhinderbar, müssen wir betonen, dass aufgrund des christliches Menschenbildes es auch im Netz Schutzräume geben muss.
Da dieser Schutz in den kommerziellen sozialen Netzwerken nicht gegeben ist, sagen die Social Media Guidelines der NRW-Landeskirchen und Bayern klar: Keine Seelsorge auf Facebook.
Das ist die rechtliche Antwort, aber wir müssen theologisch weiterdenken. Was sagen wir Vertretern der post-privacy-Bewegung? Umgang mit personenbezogenen Daten ist auch kulturell unterschiedlich geprägt, nehmen wir nur Deutschland, Skandinavien und die USA als Beispiel. Was ist öffentlich, was ist privat, was ist persönlich im Netz, dies verlangt einen eigenen Diskurs.
Der Mensch ist mehr als nur Geist
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns (Joh 1,14)
Das Wort – der Logos – Information – Bits und Bytes – Wisdom of the Crowds: Der Geist Gottes begegnet uns in seiner und unserer Körperlichkeit, der Mensch ist mehr als nur ein Geist. Wir sind als Menschen mit unserer Präsenz an einen Ort gebunden und können auch im Netz nicht losgelöst von unserem Körper existieren.
In Online-Welten, Second Life ist schon fast historisch, wenn man die Zeiträume ansieht, wie sich das Netz weiterentwickelt, wählen sich Menschen Avatare, mit denen sie in der Online-Umgebung agieren. Ob Second Life oder andere Online-Welten, in denen wir als Avatare leben, es besteht immer eine Differenz zwischen Avatar, der Online-Person, und dem Menschen, der sich den Avatar ausgesucht hat, denn dem Avatar fehlt die Körperlichkeit. Eine Studie der EKD-Internetarbeit zu Second Life zeigte, dass die meisten Menschen sich Avatare aussuchen, die zu ihrer Persönlichkeit im Real Life korrespondieren.
Auch hier liegt noch theologische Arbeit vor uns.
Inszenierung als Online-Person
In den christologischen Streitigkeiten der Alten Kirche Kirche und der Entwicklung der Trinitätslehre ging es auch um Begriffe, die ihre spezielle Bedeutung erst im Laufe der Auseinandersetzung entwickelten. Der griechische Begriff prosopon bzw. das lateinische persona sind dabei zentral.
Persona bezeichnete ursprünglich eine im antiken griechischen Theater von den Schauspielern verwendete Maske, welche die Rolle des Schauspielers typisierte. Der Name ist abgeleitet aus dem Lateinischen (personare = hindurchtönen). Daraus entwickelte sich der Begriff der Person, wie wir ihn heute kennen. In der Trinitätslehre bedeutet der Begriff Person, dass Gott uns zwar als Einer aber in drei Personen als Vater, Sohn und Heiliger Geist begegnet. Wir können von Gott nicht anders sprechen, als dass wir den Begriff der Person verwenden.
In Bezug auf das Internet sprechen wir auch von der Online-Person. Häufig steht dahinter, dass wir online jemand anders sind als im Real Life, also die Online-Persona “fake” sei. Diese Sicht trifft meines Ermessens aber nicht, was den komplexen Vorgang ausmacht, wenn jemand seine Online-Identität aufbaut. Natürlich geht es dabei um Inszenierung, aber das In-Szene-Gesetzte ist deswegen nicht weniger wirklich. Die entscheidende Frage lautet daher, wie ich mich persönlich in Szene setze. Auch im Netz zeige ich mich als Person, auch wenn ich dies nur bedingt steuern kann. Auch andere können über mich im Netz schreiben, keinesfalls nur Positives. Im Blick auf die eigenen „Veröffentlichungen“ meiner selbst habe ich hier die Möglichkeit bewusster Inszenierung. Denn „persönlich“ ist eine Inszenierung immer. Hier macht auch die urspüngliche Bedeutung des Begriffs Persona oder Prosopon Sinn, nämlich als Maske oder die Rolle des Darstellers, der Darstellerin im griechischen Schauspiel. Ich inszeniere mich als Person, bewusst oder unbewusst. Als Leitlinie für Social Media gilt daher: Verhalte dich in den Sozialen Netzwerken nicht anders als in anderen Kontexten. So kann ich anderen auch im Netz persönlich begegnen. Inszenierung führt also nicht zum Fake, sondern auch zu personaler Begegnung.
Häufig wird – gerade bei Kirchens – eine face-toface-Begegnung als ein echtes Begegnen zeier Menschen gepriesen, während ein Online-Kontakt “nur” virtuell sei. Abgesehen davon, dass virtuell ethymologisch etwas anderes bedeutet als unecht, nämlich kraftvoll, so nimmt diese abschätzige Wertung von Online-Begegnungen nicht wahr, wie sich der Aufbau einer Online-Identität vollzieht.
Manchmal ist online und offline auch nicht weit voneinander entfernt. Lange überlegte ich beispielsweise mit einem Pfarrer, welches Profilbild er von sich auf Facebook verwenden sollte. Nach langer Überlegung entschied er sich für eins mit Talar, damit machte er deutlich: Wer mich auf Facebook anspricht, begegnet mir als Pfarrer – und nicht als Privatperson. Er hat sich also als Pfarrer inszeniert. Genauso inszeniere ich mich auch als Pfarrer, wenn ich meine Kleidung für einen Geburtstagsbesuch auswähle, nämlich den Anzug und nicht die Jogging-Hose und Sweatshirt.
Online hat eigene Regeln
Die Cyberpsychology kennt den Begriff der „online inhibition“ bzw. „online disinhibition effect“:
„It’s well known that people say and do things in Cyberspace that they wouldn’t ordinarily say or do in the face-to-face world. They loosen up, feel more uninhibited, express themselves more openly. […] They reveal secret emotions, fears, wishes. Or they show unusual acts of kindness and generosity.“
Diese so charakterisierte Verhaltensweise kennzeichnet auch Verhalten in sozialen Netzwerken, sie ist Ursache für den schnellen Like-Klick auf Facebook, aber auch den Rant auf Twitter. Die Hemmschwelle, sich emotional zu äußern ist im Internet deutlich geringer. Dafür gibt es verschiedene Gründe:
- Anonymität
Online people feel they can’t be identified in the same way they can when they’re in public. It’s similar to going out in a costume at night with a mask on to cover the face. That sense of disconnection from our normal personality allows new ways of behaving. People may even consider their online behaviours to arise from an online alter ego.
- Unsichtbarkeit
Because others can’t see us online, we don’t have to worry about how we look to others and what emotional signals we are sending through facial expressions.
- Einfaches Beginnen und Beenden von Konversationen
Face-to-face we see people’s reactions to what we’ve said or done immediately. That tends to put us off upsetting them or risking their judgement.
Online there are no such restrictions: because of online asynchronicity it’s possible to say something and wait 24 hours before reading the response, or never read it at all.
- Stimmen im Kopf
The very act of reading online can create a surprisingly intimate connection. Because other people’s words are in our heads, we may merge them with our own internal monologues.
While humans have been reading novels and letters for centuries, these are relatively formal modes of communication, and it’s only in the last decade that online communication has brought the intimacy of a letter to informal, everyday conversation.
- Imaginäre Welt
The anonymity, invisibility and fantasy elements of online activities encourage us to think that the usual rules don’t apply. Like a science fiction escape fantasy, the net allows us to be who we want and do what we want, both good and bad.
- Keine Polizei
We all fear disapproval and punishment, but this imaginary world appears to have no police and no authority figures. Although there are people with authority online, it’s difficult to tell who they are. There is no internet government, no one person in charge of it all. So people feel freer online: away from authority, social convention and conformity.
Online zeigen Menschen eher wer sie sind. Gehässige Kommentare sind eine Folge, aber es bieten sich auch Chancen. Im Netz spricht sich leichter über tabuisierte Themen, dazu gehört auch Religion. Fürbitten und Gebetsanliegen sind persönlicher in Online-Gottesdiensten als bei Gottesdiensten einer an einem Ort versammelten Gemeinde. Eine Erfahrung von Chatseelsorge ist es, dass Menschen sich manchmal etwas von der Seele tippen, was man face-to-face niemandem sagen würde.
Online-Kommunikation ist anders als face-to-face-Kommunikation, online gibt es Geschwätz und tiefe Gespräche, aber auch im RL kann man quatschen oder gehaltvoll miteinander reden.
Aber auch bei Chatseelsorge gilt: Das Parochialsystem ist das Problem, warum wir nicht genügend Pfarrerinnen und Pfarrer als Seelsorgende haben.
Online-Gemeinden?
Religionssoziologisch lässt sich zwischen Religion online und Online-Religion unterscheiden. Religion online bezeichnet über Religion im Internet verfügbare Informationen, Online-Religion dagegen im Internet gelebte religiöse Praxis.
Das Internet ist auch ein Ort spiritueller Erfahrungen und gelebter Frömmigkeit. Vom Morgengruß auf Twitter bis zum geistlichen Schlusswort auf Facebook.
Solche religiösen Angbote im Netz sind oft komplentär zu dem, was Ortgemeinden anbietern.
Wer online an einem Nachtgebet auf Twitter teilnehmen möchte, geht zur Twomplet (Twitter-Komplet). Nicht jede Gemeinde bietet ein Nachtgebet an, daher ist die Twomplet eine sinnvolle Ergänzung. Wer am Ewigkeitssonntag seiner Angehörigen namentlich gedenken möchte, kann dies über Chat auf Trauernetz.de tun. In einer Ortsgemeinde werden am Ewigkeitssonntag nur die Namen der im letzten Jahr in dieser Gemeinde Verstorbenen verlesen, möchte ich aber eines oder einer vor längerer Zeit Verstorbenen namentlich gedenken, geht dies nur in einer Online-Andacht. Im Netz finden sich daher Menschen zusammen, deren spezielle religiöse Bedürfnisse von Ortsgemeinden nicht abgedeckt werden können.
Die unitarische Church of the Larger Fellowship reicht bis in die Zeit des Wilden Westens zurück. Reisende Evangelisten kümmerten sich um die Seelsorge bei Ranchern und versorgten sie mit Traktaten. Daraus entwickelte sich im letzten Jahrhundert eine Gemeinde mit einer Schriftenmission, mit der Verbreitung des breitbandigen Internets dann eine Online-Gemeinde. Diese Entwicklung war möglich, da es für die Gemeindeglieder selbstverständlich ist, ihre Pfarrerin über Spenden zu bezahlen. Die United Church of Christ baut seit 2013 eine Online-Gemeinde auf, ein besonderes Ziel ist es, Menschen zu erreichen, die aufgrund der Entfernung ihres Wohnortes zur nächsten Gemeinde am Gemeindeleben nicht teilnehmen könnten. Dabei ist es selbstverständlich, dass sich die Gemeinde auch um die Finanzierung kümmern muss und daher gezielt Spenden einwirbt. In Deutschland wird es vermutlich reine Online-Gemeinden in absehbarer Zeit nicht geben, denn es paart sich die Kostenlos-Mentalität im Internet mit dem deutschen Kirchensteuer- und Parochialsystem. Wer ist bereit, für die Mitgliedschaft in einer Online-Gemeinde zusätzlich zu seiner bereits geleisteten Kirchensteuer zu bezahlen? Andererseits ist jeder Ort in Deutschland über das Parochialsystem einer Ortsgemeinde zugeordnet, so dass strukturell keine Notwendigkeit für eine Online-Gemeinde besteht, da jedes Kirchenmitglied aufgrund seines Wohnsitzes pastoral versorgt ist. Das deutsche Kirchenmitgliedschaftsrecht sieht auch nicht vor, dass die EKD Gemeindegründungen im Internet vornimmt, und Landeskirchen werden vermutlich auch nicht Gemeindegründungen forcieren, da sich Online-Gemeinden nicht auf landeskirchliche Grenzen beschränken, sondern am Sprach- und Kulturraum orientieren. Reine Online-Gemeinden wird es vermutlich in Deutschland – anders als in den USA – nicht so bald gegeben. Denn Online-Gemeinden sind nicht kompatibel zum deutschen Parochial- und Kirchensteuersystem. Unsere amerikanische Partnerkirche United Church of Christ setzt auf eine Online-Gemeinde, weil die landesweite Präsenz in der Fläche nicht mehr gegeben ist. In Deutschland kann uns das nicht passieren, da jede Geo-Location einer Kirchengemeinde zugeordnet ist.
Internetgottesdienste
Reine Internetgemeinden werden natürlich auch Gottesdienste miteinander feiern. Dabei gibt es verschiedene Formate.
Aber es gibt auch Ortsgemeinden, die ihren Gottesdienst im Internet übertragen. Ein gutes Beispiel dafür ist die evangelische Markuskirche in Wien. Regelmäßig werden Gemeindegottesdienste gestreamt, vorab lassen sich Gebetsanliegen in eine Online-Gebetbuch eintragen. Diese Diaspora-Gemeinde aus Wien holt sich so Gottesdienstteilnehmer aus dem gesamten deutschen Sprachraum in den Gemeindegottesdienst.
Natürlich macht der Videostream an den Parochialgrenzen keinen Halt, das Zentrum der Gemeindearbeit und des Gemeindelebens bleibt die Ortsgemeinde, aber das Internet weitet diese aus So öffnet das Internet auch konventionelle “brick and mortar churches”.
Neuzugezogene können niederschwellig den Stream ansehen und sich dann entscheiden, ob sie den nächsten Gottesdienst in der Kirche besuchen wollen oder lieber daheim bleiben. Ehemalige Gemeindeglieder, die sich vielleicht ihrer Gemeinde am neuen Wohnort nicht verbunden fühlen, können so Kontakt zu ihrer alten Gemeinde halten. Das globale Netz ist dann auch ganz lokal: Auch Bewohnerinnen und Bewohner eines Seniorenheims können statt einen wechselnden Pfarrer im Fernsehgottesdienst ihren Ortspfarrer oder ihre -pfarrerin predigen hören, denn Online-Streams lassen sich auch auf modernen TV-Geräten abspielen.
Ich erhalte häufiger Anfragen von Gemeinden, die statt des Kassettendienstes ihre Gottesdienste streamen wollen. Am größten sind dabei die rechtlichen Hürden.
Bis an der Welt Ende
Das war jetzt eine kurze Rundreise durch Neufundland. Sie haben meinen Pessimismus gespürt in Bezug auf den Gesamtblick.auf die Kirche als Institution. Aber – und das betone ich sonst immer wieder – Kirche ist mehr als die Institution und Web 2.0 und Social Media setzt auf einzelne Akteurinnen und Akteure. Wenn ich sehe, was dann wieder an der Basis passiert, was engagierte Menschen einfach machen, ohne auf Strukturen zu achten, bin ich dann doch optimistischer. Und gespannt, was ich an diesen Tagen hier in Loccum erleben werde.
Viele sind bereits heimisch geworden in der Welt des Internet, andere fremdeln noch. Gott hat aber seine Gegenwart verheißen bis an der Welt Ende, das schließt mit Sicherheit auch das #Neufundland ein.
***